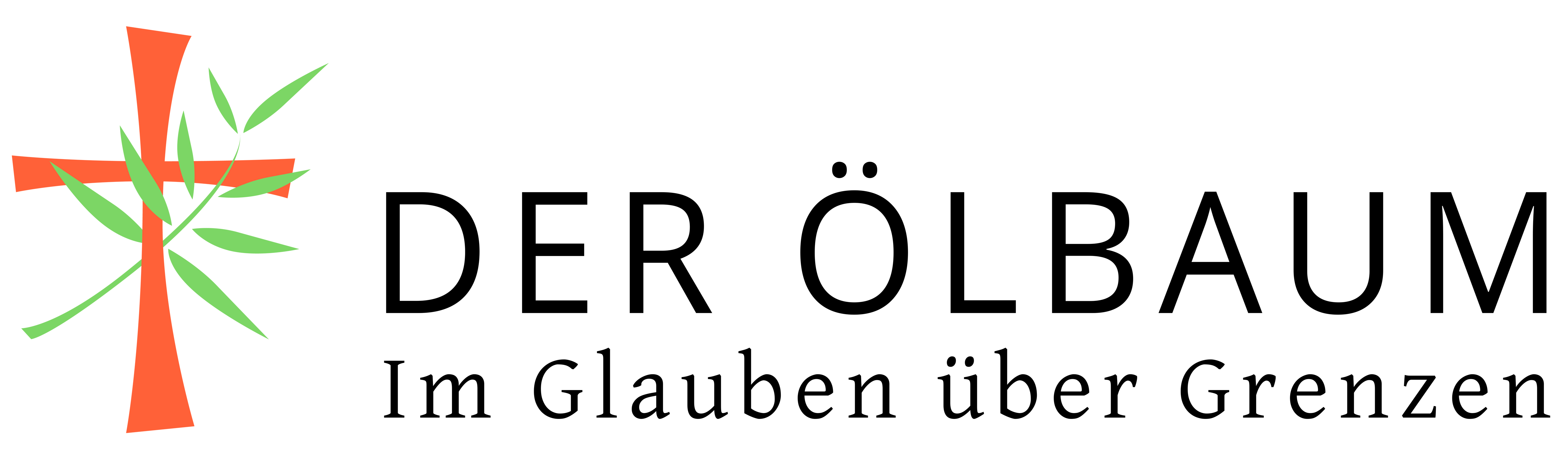Text: Lutz Debus
Bilder: Christoph Schönbach
Von Innen ist schon das Orgelspiel zu hören. Draußen, vor der Tür der Sankt-Petrus-Kirche in Wuppertal-Laaken warten noch zwei ältere Damen. Sie lächeln sich an. „Es ist neu. Aber es ist bestimmt gut“, sagt die Eine zu der Anderen. Sie scheint ihr Mut zusprechen zu wollen. Beide treten ein. Drinnen gibt es kaum mehr freie Plätze. Zwei junge Männer, braungebrannt, mit hautengen T-Shirts und Jeans bekleidet, bieten den Damen ihre Plätze an.
Die Kirche ist voll. So voll wie schon lange nicht mehr. Eigentlich sollte sie sogar geschlossen werden, verkauft, vielleicht abgerissen, wegen der fehlenden Besucher. Aber es gibt neue Pläne. Eine christlich-orientalische Gemeinde könnte hier im Südosten von Wuppertal eine Heimat finden. Um diese zunächst theoretische Möglichkeit mit Leben zu füllen, entschieden sich die Organisatoren der „Laakener Messe“, ihre jährlich stattfindende Veranstaltung von dem sonst immer genutzten Spielplatz direkt an der Wupper in die bedrohte Kirche zu verlegen und die orientalischen Christen dazu einzuladen. Etwa dreißig Gläubige – überwiegend aus Syrien – sind gekommen. Die anderen Besucher sind Alteingesessene aus den umliegenden Pfarrgemeinden.
Pfarrer Benedikt Schmetz begrüßt die Gekommenen. „Herzlich Willkommen heiße ich auch unsere Besucher aus Syrien und Jerusalem“, ergänzt er. Es sei ihm eine Freude, dass sich solch eine internationale Gemeinschaft hier versammelt habe. Man kenne sich ja nicht. Die Gemeinsamkeit und das Verbindende sei der Glauben an Jesus Christus.
Nach einem Lied, das die Anwesenden, unterstützt vom Singkreis von St. Raphael, intonieren, erklärt Gemeindereferent Max Straetmanns das Motto des Festtages. „Laken für Laaken“ sei nicht nur ein Wortspiel. Tatsächlich habe es in dem Örtchen Laaken viele Jahre eine Fabrik gegeben, die Textilien bedruckt habe. In dieser Tradition haben nun viele Gruppen und Kindergärten der umliegenden beteiligten Gemeinden für den heutigen Tag Laken gestaltet, die verschiedene Bibelstellen illustrieren. Eine bunte Weltkugel ist zu sehen. „Diese ist umrahmt von bunten Patschhändchen“, erläutert Straetmanns. Der Kindergarten wollte so die Vielfalt des Lebens auf dieser Welt ausdrücken. Daneben hängt eine kunstvolle Gestaltung. Stoffapplikationen erinnern stilistisch an einen Wandteppich der Indios. Darauf erkennt man die Szene, in der der Schäfer gerade ein Schaf aus seiner Herde verliert. Beide Seitenwände des Kirchschiffes sind mit solch gestalteten Stoffbahnen behangen.
Im Anschluss an den Vortrag von Max Straetmanns wird ein Auszug aus dem Brief Paulus an Thimotheus gelesen, zunächst auf Deutsch, dann auf Arabisch. Manch älterer Kirchbesucher guckt erstaunt, als die fremden Klänge der arabischen Sprache, die ja oft im Zusammenhang mit dem Islam zu hören ist, durch das Gotteshaus schallen.
Pfarrer Ulrich Lemke erzählt nach einem weiteren Lied von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium. Der Sohn, der das ihm vom Vater anvertraute Geld verprasst und dann, völlig ausgehungert, wieder nach Hause kommt, wird vom Vater herzlich empfangen und beschenkt. Sein Bruder aber grollt, weil er, der kein Vermögen sinnlos ausgegeben hat, nicht besser behandelt wird. Wer nun der verlorene und wer der neidische Sohn ist, lässt Pfarrer Lemke unbeantwortet.
Als Pfarrer Benedikt Schmetz die Kommunion austeilt, strömen Altwuppertaler wie Flüchtlinge nach vorne zum Altar. Dieses gemeinsame Handeln ist nicht durch Sprachbarrieren behindert. Zum Ausklang intoniert der Singkreis das bekannte amerikanische Lied „We shall overcome“. Manchem Besucher stehen die Tränen in den Augen.
Beim anschließenden Beisammensein im Pfarrsaal und im Kirchgarten ist ein Gespräch zwischen arabischen und deutschen Christen schwieriger. Übersetzer fehlen. Manch ältere Wuppertaler stochern mit ihren Gabeln etwas ratlos in den angebotenen Reisgerichten. Ebenso ratlos stochern wiederum die arabischen Gäste mit ihren Gabeln in den Kuchenstücken. Nicht nur die Liebe, sondern auch das Fremde geht hier durch den Magen.
Wie ihm der Kuchen schmecke, wird Fadi Al Assatin gefragt. Der 37-jährige Syrer antwortet mit einem zögerlichen Lächeln. Das gemeinsame Fest gefalle ihm gut, erklärt er. Dann aber erzählt er von seinem Schicksal. Seine Frau und seine drei Kinder leben nach wie vor in Daranja, einer etwa 250.000 Einwohner zählenden Stadt in Syrien. Er mache sich große Sorgen um sie. Sein eigenes Haus und sein Auto wurden von der Assad-Regierung beschlagnahmt. Seine Mietshäuser, die ihm bis zu Beginn des Bürgerkrieges ein gutes Leben in Syrien ermöglichten, seien inzwischen durch Artilleriebeschuss der ISIS-Truppen in Schutt und Asche gelegt worden. Seinen materiellen Verlust durch den Bürgerkrieg beziffert er auf eine Viertelmillion Euro. Schlimmer aber sei die Ungewissheit, wie es mit seiner Familie weitergehen wird. Gerade bekam er den Bescheid von der Bezirksregierung Arnsberg, dass er zunächst nur geduldet sei. Einen Antrag auf Familienzusammenführung könne er so frühestens 2018 stellen. Ob seine Familie bis dahin noch lebe, schließlich seien Christen durch die islamistischen Gotteskrieger besonders bedroht, könne niemand sagen. Von den 340 Euro, die er als Unterstützung bekomme, schickt er 100 Euro im Monat zu seiner Frau, um die schlimmste Not zu lindern. Der Rest bleibt ihm für sein Leben in einer Flüchtlingsunterkunft in Brilon.
Bei dem jungen Mann steht Ranka Saad mit ihrem Sohn. Die 52-jährige sieht eigentlich jünger aus. Nur ihre Augen verraten, dass dieser Mensch schon sehr viel erlebt hat. Der 24-jährige Sohn, der schon etwas besser Deutsch spricht, versucht zu übersetzen. Nur ihr und ihrem Sohn war es möglich, aus Syrien zu fliehen. Ihr Mann, ihr anderer Sohn und die Tochter seien noch unten, erzählt die Frau mit dem lockigen Haar und versucht, Haltung zu bewahren. Zwei Mal seien sie in den letzten Jahren ausgebombt worden. Nun habe ihr die Behörde mitgeteilt, dass ihr Mann und ihr Sohn nach Deutschland kommen dürfe. Ihrer Tochter aber werde die Einreise nicht erlaubt. Sie ist schon volljährig und falle deshalb nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Nachzug von Familienangehörigen. „Aber mein Mann kann doch eine Achtzehnjährige nicht allein im Krieg zurücklassen“, klagt Ranka Saad. Ein Widerspruch ist schon abgeschickt. Aber wenn es zu einem Prozess komme, sei ein Anwalt teuer.
An einem anderen Tisch sitzt Hagit Noam. Die Israelin jüdischen Glaubens ist kurzfristig zu dem Fest eingeladen worden. Die klassische Sängerin gastierte zwei Tage zuvor in Wuppertal bei der „Nacht der Mystik“ in der Basilika St. Laurentius. Die Musiktherapeutin und Feldenkraislehrerin ist mehrere Male im Jahr in Deutschland. Es sei für sie besonders schön gewesen, von den arabischen Organisatoren des Festes auf Hebräisch eingeladen worden zu sein. Das Verhältnis der Juden und der christlichen Araber sei in Israel recht entspannt, kein Vergleich zu dem zwischen Juden und Arabern muslimischen Glaubens. So war es für sie selbstverständlich, die Einladung anzunehmen.
Ein älterer Herr aus Barmen steht am Rande des Pfarrgartens und macht ein nachdenkliches Gesicht. „Früher haben wir für Misereor gesammelt. Jetzt kommt die Misere zu uns.“ Für ihn sei es selbstverständlich, dass man helfen müsse. Er kann sehr gut verstehen, wenn Menschen, die von Krieg und Hunger bedroht sind, zu uns kommen. „Die Welt ist mit dem Internet kleiner geworden. Deshalb können wir uns nicht mehr damit zufriedengeben, jeden Sonntag ein paar Euro zu spenden.“ Allerdings sei er sich nicht sicher, wer nun der verlorene und wer der andere Sohn des Vaters sei. Damit spielt er auf die Bibellesung in der Messe an. „Die Flüchtlinge in ihrer Not sind vielleicht viel näher bei ihrem Vater als wir satten Deutschen“, vermutet er. Kurz nach 1945 waren die Gotteshäuser voll gewesen, gibt er zu bedenken. „Da wäre niemand auf die Idee gekommen, eine Kirche abzureißen.“ Die Flüchtlinge mit ihren schweren Schicksalsschlägen erinnern ihn an seine Eltern, als diese kurz nach dem Krieg nach Wuppertal kamen.
Pfarrer Lemke steht noch lange in der sich inzwischen geleerten Kirche, schaut auf den Altar. „Für mich war die Messe sehr schön. Nein, sie war nicht nur sehr schön, sie war wunderbar.“ Sie war, so ergänzt er erneut, dem eigentlichen Wortsinn nach katholisch. Katholisch bedeutet nämlich allumfassend. Auch die beiden älteren Damen, die vor der Messe noch zögerten, einzutreten, sind ergriffen. „Es war gut, es war sehr gut, hier gewesen zu sein“, sagt die, die überzeugt werden musste, zu ihrer Begleiterin.