
Text: Lutz Debus
Bilder: Christoph Schönbach
Es sind 40 Stufen bis zum Heiligen Petrus. Natürlich, der Volksglaube sieht ihn an als Türsteher an der Himmelspforte, auch als Regenmacher. Deshalb ist ein Weg zu ihm Richtung Himmel eigentlich nachvollziehbar. Aber in dem kleinen beschaulichen Wuppertaler Stadtteil Laaken ist dieser Weg nicht symbolisch zu beschreiten, sondern sehr irdisch und auch etwas beschwerlich. Die Kirche Sankt Petrus ist auf einem Hügel gebaut und nur über eine etwas schmucklose Betontreppe zu erreichen. Diese Hanglage wurde ihr fast zum Verhängnis und hat auch viel mit der hier erzählten Geschichte zu tun.
Über seinem breiten Kreuz spannt sich ein kariertes kurzärmliges Hemd, Roland Penk ist einer, der zupacken kann. Freundliche, neugierige Augen schauen durch die Brillengläser. Penk arbeitet im Einzelhandel. Hier, vor der Kirche stehend, ist der 49-jährige aber geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Und er erzählt die Geschichte dieser Kirche, für die er mit verantwortlich ist. Dabei merkt man, dass ihm dieses Gebäude ans Herz gewachsen ist.

1910 wurde das Gotteshaus erbaut. Vielleicht sollte es ein römisch-katholischer Stachel im Fleisch des bis dahin zutiefst protestantischen Örtchens Laaken darstellen. Doch bestimmt war auch ein Bedarf nach einer katholischen Gemeinde entstanden. Nach der Jahrhundertwende verwischten durch die Zuwanderung von Arbeitskräften in die Industrieregion von Barmen und Elberfeld immer mehr die alten Grenzen zwischen protestantisch und katholisch dominierten Regionen, die Mitteleuropa seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges prägten. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts siedelte sich die Textildruckerei „Schlieper und Baum“ in Laaken an. Aus der Handvoll Bauernhäusern wuchs eine Siedlung. Die beiden Weltkriege überstand das schmucke Kirchengebäude unbeschadet. In den Sechziger Jahren aber drohte das Kirchenschiff einzustürzen. Der Berg war in Bewegung geraten. So musste es abgerissen werden. Nur der Turm blieb erhalten. Neben ihm wurde aus grauem Beton ein neuer Kirchraum gegossen. Sachlich, ein wenig kühl, wirken die Linien des Innenraums. 200 Gläubige passen in die Holzbänke.
Doch die Zeiten, in denen die Bänke in Sankt Petrus bei der Heiligen Messe bis auf den letzten Platz besetzt sind, sind längst vorbei. Schon vor 30 Jahren fragte man sich in Laaken, wie es mit der katholischen Kirche weitergehen könne. Der alte Pfarrer war gerade verstorben, seine Aufgaben übernahm zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben der Pfarrer der Nachbargemeinde Sankt Elisabeth. Sonntags um 9 Uhr stand er in Sankt Petrus vor dem Altar, um 10.30 Uhr in Sankt Elisabeth. „Beim Pfarrerwechsel gehen immer Leute flöten“, weiß Roland Penk zu berichten. Aber wenn es keinen Pfarrer gibt, der sich ganz auf seine Gemeinde konzentrieren könne, ist der Abwärtstrend oft noch fataler. Vor sieben Jahren fanden sich am Sonntag manchmal nur noch ein Dutzend Christen in der Kirche ein. „Die Gemeinde ist überaltert“, gibt Penk zu. Und gerade den Alten fiel der Aufstieg zu ihrer Kirche immer schwerer. „Wie soll eine Seniorin mit Rollator über die steilen Treppen zu uns kommen?“ Roland Penk senkt seine Stimme, ringt nach Worten. „20.000 Euro verschlingt die Kirche jährlich allein an Unterhaltskosten.“ Darin sei die Rücklagenbildung für nötige Reparaturen noch nicht enthalten. Vor einigen Jahren gab es einen Wasserschaden infolge einer undichten Stelle im Dach. Die Versicherung zahlte glücklicherweise. Ansonsten hätte es schlimm ausgesehen.

Roland Penk lässt seinen Blick über die leeren Kirchenbänke schweifen. „Was das mir an Bauchschmerzen bereitet hat…“ Penk ist für die finanziellen Belange der Gemeinde mitverantwortlich. Schweren Herzens habe man die Profanisierung der Kirche beantragt. Profanisierung, das bedeutet im Klartext, man habe das Ende der Gemeinde in Laaken und den Umbau, gar vielleicht den Abriss der Kirche beantragt. „Jede Schließung einer Kirche ist furchtbar“, erklärt Penk, „auch dann, wenn sie aus kaufmännischer Sicht unumgänglich ist.“
Die Zeit nach der Beantragung hat der Kirchenvorstand in schlechter Erinnerung. Es ging darum, wohin die Kunstgegenstände, die Orgel und das Allerheiligste, das Tabernakel kommen, wenn Sankt Petrus geschlossen würde. Nach Polen? Nach Russland? Die Wege des Vatikans sind manchmal für Laien unergründlich. Ein Fotograf machte unzählige Bilder. Ein Architekt fertigte Zeichnungen an. Zumindest auf dem Papier sollte die Kirche weiterbestehen. Der Architekt allerdings war mit einer Journalistin vom Fernsehen befreundet. So bekam Roland Penk eines Abends einen Anruf. Man habe erfahren, die Kirche in Laaken solle geschlossen werden. In aller Eile wurde eine Pressekonferenz einberufen. Und tatsächlich war es nicht einfach, der Öffentlichkeit und besonders den Menschen in Laaken zu vermitteln, dass die Kirche, in denen viele getauft worden waren und in denen viele geheiratet hatten, nicht mehr existieren sollte.
Dass das Gebäude nicht schon längst einer Eigenheimsiedlung oder einem Supermarkt Platz gemacht hat, verdankt es seiner Lage. Die Freitreppe aus Beton kann nicht abgerissen werden, weil sie den Hang stützt. Aber die baupolizeilichen Auflagen für Neubauten wiederum vertragen sich nicht mit dem grauen Ungetüm mit den vierzig Stufen. So hat man bis heute keinen Käufer gefunden. Die Kosten für die Kirche allerdings belasteten von Jahr zu Jahr mehr den Etat der Gemeinde.

„Von dem Plan, die Kirche zu einem Gotteshaus für arabische Christen zu machen, erfuhr ich aus der Presse“, erzählt Roland Penk. Zuerst war der Kirchenvorstand, der ja nach dem Pfarrer der wichtigste Mann in der Gemeinde ist, deutlich irritiert. „Ich habe wohl sehr erstaunt geguckt, als ich da vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.“ Aber nach zehn Minuten des Haderns habe er sich mit dem Gedanken angefreundet, dass nun vielleicht andere, fremde Menschen die verwaiste Kirche nutzen können. Und dann fuhr er zu der Nachbarkirche Sankt Elisabeth, setzte sich an die Orgel und spielte „Großer Gott, wir loben Dich“. Ganz für sich allein. In der sonst leeren Kirche. Alle Register gezogen.
Wie aber kam der rasche Sinneswechsel? Die Kirche müsse, so Roland Penk, eine Kirche der Armen und Verfolgten sein. Die Ermahnungen von Papst Franziskus nehme er da sehr ernst. Früher war die Kirche organisiert wie eine Pyramide. Ganz oben der Pontifex, dann die Kardinäle und Bischöfe, die Pfarrer und ganz unten die normalen Gläubigen. „Das Weihwasservolk“, so nennt Penk schmunzelnd die einfachen Kirchgänger. Und diese Pyramide habe Papst Franziskus auf den Kopf gestellt. Er, der Papst, und natürlich auch die anderen Kirchenoberen sollen den einfachen Gläubigen dienen. Um das zu verdeutlichen, formt Penk mit den Händen ein Dreieck, das die Spitze oben hat. Dann kippt er die Hände und es entsteht eine Art Trichter. „Damit setzt Franziskus endlich das um, was das Zweite Vatikanische Konzil seit über 50 Jahren fordert.“ Zumindest für einige Augenblicke steht die Pyramide auf ihrer Spitze. Dann senkt Roland Penk seine Hände, geht zur Orgel und spielt noch einmal das Lied, das er vor Wochen in Sankt Elisabeth spielte.

Nachdenklich ist sein Blick, als er sich wieder zu seinen Besuchern dreht. Merkel habe wohl recht. Wir schaffen das. Wahrscheinlich schaffen wir das, schränkt Penk ein. „Und natürlich müssen wir allen Menschen in Not helfen. Aber besonders müssen wir unseren Schwestern und Brüdern im Glauben helfen.“ Dazu sei man unter anderem laut Kirchenrecht sogar verpflichtet. „Mir sind die Christen unter den Flüchtlingen aus Syrien näher als die Mohammedaner“, räumt der Kirchenvorstand ein. Beruflich habe er oft sowohl mit Flüchtlingen christlichen wie auch mohammedanischen Glaubens zu tun. „Die Christen sind auf eine warmherzige Art demütig.“ Man fragt ihn vorsichtig nach den gesuchten Waren. Männer in Begleitung von Frauen mit Kopftuch oder Schleier hingegen fassen ihn an den Ärmel, ziehen ihn durch das Geschäft, um sich durchzusetzen.
Vor einigen Wochen gab es in der Kirche Sankt Pius eine Messe für arabische Christen. Roland Penk war neugierig und ging hin. Von der Predigt, die auf Arabisch gehalten wurde, verstand er nichts. So schaute er sich um. Die Kirche war voll. Voll mit überwiegend jungen Menschen. Die Männer waren oft tätowiert. Das schreckte ihn zunächst ab. Tatoos findet Penk eher abstoßend. Dann aber sah er genauer hin. Auf den Oberarmen der jungen Männer sah er Kreuze und auch Abbildungen von Jesus und Maria. Diese Tätowierungen waren nicht frisch gestochen. Schon in Syrien waren diese Menschen so tätowiert und trugen in dem Land, in dem der IS sein Unwesen treibt, durch dieses offensichtliche und unauslöschbare Bekenntnis ein erhebliches Risiko. „In Deutschland bekennen sich wenige Christen offen zu ihrem Glauben, obwohl es hier völlig ungefährlich ist“, gibt Penk zu bedenken. Besonders berührt aber habe ihn etwas ganz Anderes. „Fast alle Versammelten hatten Tränen in den Augen.“ Viele Monate oder gar Jahre war es den Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak unmöglich gewesen, die Heilige Messe in ihrem eigenen liturgischen Ritus zu empfangen. Und nun, tausende Kilometer von ihrer Heimat, durften sie endlich wieder ihren Glauben feiern.
Roland Penk ist sehr optimistisch, dass die neue Gemeinde in Wuppertal auch positive Auswirkungen auf die Wuppertaler Katholiken haben wird. Man werde voneinander lernen. „Mich kriegen Sie von dieser Schiene nicht mehr runter.“

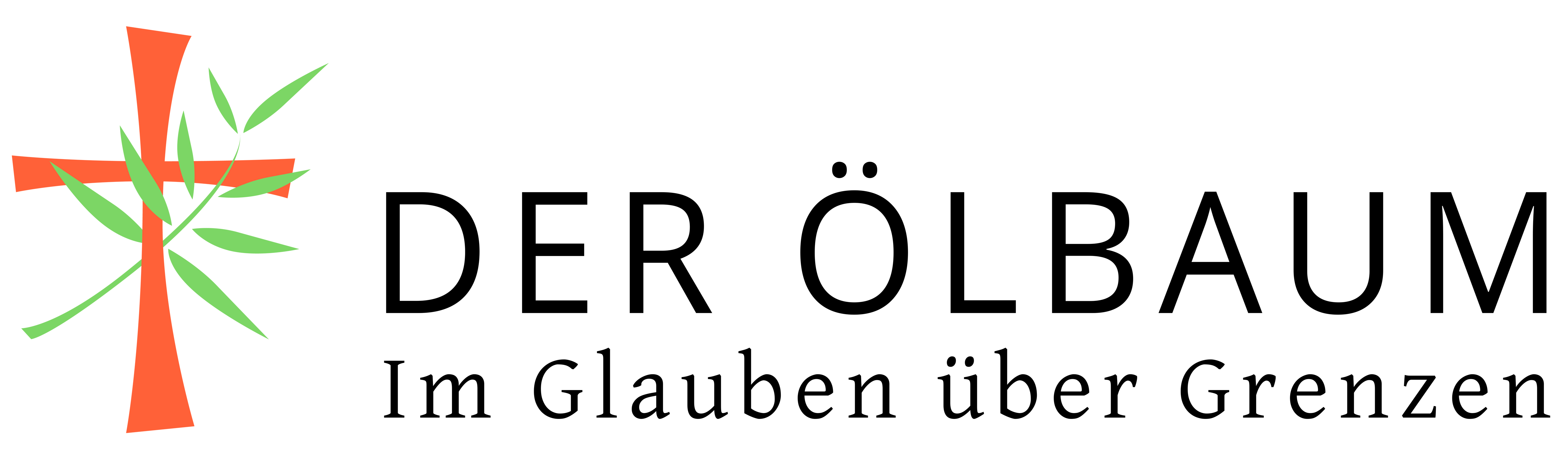
Schöner Artikel, über ein spannendes Thema und wunderbare Fotos. Mehr davon! 🙂
Danke,